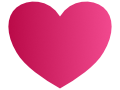#gerneperdu steht heute in vielen Signaturen – doch sind wir im echten Leben wirklich schon so weit? Über den Umgang mit Nähe und Distanz hier und anderswo auf der Welt.
Neulich las ich über eine bemerkenswerte japanische Gepflogenheit: Büroangestellte, die früh zur Arbeit kommen, stellen ihr Auto auf dem Firmenparkplatz so weit hinten wie möglich ab – sie überlassen damit den Spätkommern die Pole Position am Eingang, damit auch diese es noch rechtzeitig ins Büro schaffen. Dieses Verhalten entspricht dem japanischen Konzept von Kikubari: die Kunst, andere mit Umsicht zu behandeln. Das Wohl der Gruppe und das Vorausahnen der Bedürfnisse anderer stehen dabei an oberster Stelle.
Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt sind in Japan nicht nur gelebter Alltag, sondern tief verankerte kulturelle Prinzipien – sichtbar in Gesten wie dem Verbeugen, dessen Neigung je nach Gegenüber fein abgestufte Höflichkeitsgrade ausdrückt. Auch die japanische Sprache kennt zahlreiche Ebenen der formellen und informellen Ansprache, die präzise soziale Hierarchien widerspiegeln. Der Wechsel vom höflichen zum vertrauten Ton ist dort ein bewusster, oft bedeutungsvoller Schritt.
Das Du: Digital so nah – analog oft noch fern
Damit komme ich zum eigentlichen Thema, die Sache mit dem vertrauten “Du” und dem höflichen “Sie” hierzulande und den zunehmend fließenderen Übergängen. Früher war klar: Man sagte „Sie“, bis das „Du“ angeboten wurde – ob im Büro, Bistro oder beim Bäcker. Funktioniert das heute noch so?
‘Gerne per Du’?
In der digitalen Kommunikation ist das „Du“ ja inzwischen praktisch Standard: auf Webseiten, in Newslettern, Social Media und in persönlichen E‑Mails, die unter der Signatur mit #gerneperDu auch den letzten Zauderern noch eine Brücke anbieten.
Diese Gepflogenheit macht es heutzutage einfach, nahbar, offen und unkompliziert, kurzum irgendwie auf Augenhöhe zu erscheinen.
Oder ‘Lieber per Sie’?
Was das Duzen im virtuellen Raum betrifft, so habe mich, ehrlich gesagt, inzwischen daran gewöhnt. Doch eine Begegnung in der analogen Welt ist eine Begegnung mit der Realität, wo etwas wie Alter und Status des Gegenübers sichtbar werden. Und da kommt der Kulturwandel doch nicht so schnell mit: Das Du, das digital so selbstverständlich ist, weicht in der Realität oft wieder dem „Sie“. Face-to-face mit mir älterer Person können 20- oder 30-Jährige das “Sie” nur schwer loslassen; das fällt mir immer wieder auf.
Für Start-ups & KMU
Digitale Nähe bewusst gestalten: Wer seine Kunden online auf Augenhöhe anspricht, wirkt sympathisch und vertrauenswürdig. Ein #gerneperdu-Ton kann hier kleine Wunder wirken. Mehr auch unter Digitale Markenstrategie.
Du und Sie … anderswo
Wird das Du auch in unserer Kultur über kurz oder lang seinen festen Platz finden? Dafür spricht die Dominanz des Englischen in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung. Das Englische kennt nur “you”, egal ob ich mit dem Großvater oder der CEO spreche. “You” lässt sich zwar nicht direkt mit dem deutschen Du gleichsetzen, erzeugt jedoch häufig denselben Eindruck von Vertrautheit – besonders, wenn die Anrede mit dem Vornamen kombiniert wird. Der Unterschied zur höflichen Ansprache wird über Tonfall, Wortwahl und Höflichkeitsfloskeln vermittelt: Would you mind…? klingt anders als Can you…?
Auch bei unseren niederländischen Nachbarn ist “u” (“Sie”) im Alltag kaum noch gebräuchlich und wird nur in deutlich formellen Kontexten oder gegenüber Senioren angewandt; es überwiegt das informelle “Du”, “je/jij“.
In Skandinavien ist das Duzen gesellschaftlicher Konsens. Egal ob auf dem Amt, in der Schule oder im Krankenhaus: Alle sagen Du. Respekt zeigt sich nicht über Distanz, sondern über den Umgang.
In meinem Beitrag Dört Gözle habe ich schon erzählt, dass ich gerade Türkisch lerne – eine Sprache mit besonders differenzierten Anredeformen. Neben der grammatischen Unterscheidung zwischen vertraut („sen“) und förmlich („siz“) werden Vorname und Höflichkeitstitel kombiniert, z. B. „Erol Bey“ oder „Aylin Hanım“. Darüber hinaus dienen familiäre Titel wie Abi (großer Bruder), Abla (große Schwester) oder Teyze (Tante) als respektvolle Anrede – unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. So wird die Kollegin zur Elif Abla, die Nachbarin zur Emine Teyze, der Gemüsehändler zu Mehmet Abi.
Die türkische Sprache erlaubt damit, Nähe und Respekt gleichzeitig auszudrücken – ein warmherziger, respektvoller Ton ohne strikte Entscheidung zwischen Siezen und Duzen.
Es muss nicht immer “Sie” sein
Ob Verbeugung, Handschlag oder soziale Titel: Es gibt also viele Wege, Respekt und Rollen auszudrücken – nicht immer braucht es dafür ein „Sie“. In der deutschen Sprache, so scheint es mir, definieren wir gerade unseren Ausdruck für Nähe und Höflichkeit neu. Wir machen uns die Duzkultur im Netz immer mehr zu eigen, hinken aber analog zuweilen noch hinterher, getragen von einem gewissen Unbehagen, mit der Tradition zu brechen…
Ich finde: Solange der Ton stimmt, darf auch die Form flexibler werden. Und wenn wir dabei noch ein bisschen Kikubari mitlernen, wär das doch gar nicht so verkehrt.
Dieser Beitrag findet große Resonanz. Als Dankeschön gibt es zwei Sticker-Designs für Signatur oder Social Media: Einfach per Klick hier kostenlos herunterladen: